Es war einmal…
So fangen Märchen an, die man kleinen Kindern als gute Nacht Geschichte erzählt. So kennt man die Geschichten von den Gebrüdern Grimm oder Hans Christian Andersen.
Märchen gehören zu den ältesten Geschichten der Menschheit.
Wir alle kennen sie. Dornröschen, Schneewittchen, Aschenputtel, Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, der Froschkönig.
Wir sind mit ihnen aufgewachsen, haben sie vorgelesen bekommen oder als bunte, kinderfreundliche Filme sehen. Es gibt genug Adaptionen, die die Märchenwelt aufgreifen, wie „Das 10. Königreich“, die Kinderserie „Simsala Grimm“, „Hansel und Gretel Hexenjäger“, „Brothers Grimm“ oder „Shrek“.
Doch die Versionen, die wir heute kennen, sind oft weit entfernt von dem, was diese Geschichten ursprünglich einmal waren.
Märchen waren nie kinderfreundlich im Ursprung. Sie waren voll von Sex, Gewalt und Kannibalismus.
Sie waren düstere Warnungen, gesellschaftliche Spiegel und manchmal regelrechte Horrorerzählungen. Ein typisches Beispiel ist die Geschichte von Aschenputtels Stiefschwestern, die als Sinnbild für Gier und Macht standen.
Warum wurden Märchen verändert?
Die ursprünglichen Märchen spiegelten Ängste, gesellschaftliche Regeln und moralische Warnungen wider.
Sie waren nicht für Kinder gedacht, sondern eher für Erwachsene, um Verhaltensregeln und Moral zu vermitteln.
Mit der Zeit wurden diese Geschichten angepasst, um sie familienfreundlicher zu machen.
Disney schuf ab 1937 mit Schneewittchen einen völlig neuen Standard für Märchen.
Blut, Tod und Gewalt verschwanden.
Aus brutalen Warnungen wurden Geschichten über Liebe, Hoffnung und Glück.
Doch damit ging auch ein Stück Wahrheit verloren.
Die ursprünglichen, oft grausamen Botschaften verblassten hinter Zuckerwatte und Glitzer.
Märchen damals vs. heute
Aschenputtel / Cinderella
Ursprung (Gebrüder Grimm):
Aschenputtel war als erste Erzählung nur ein armes, stilles Mädchen, das auf ihre Rettung wartet.
Ihre Stiefschwestern waren so besessen vom Prinzen, dass sie sich Teile ihrer Füße abschnitten, um in den berühmten Schuh zu passen.
Blut tropfte aus den Schuhen bis Tauben den Betrug verrieten.
Am Ende wurden den Stiefschwestern von den Tauben die Augen auf der Hochzeit ausgepickt.
Diese Version war eine Warnung vor Neid, Habgier und dem Preis von Verrat.
Disney-Version:
Hier helfen Aschenputtel fröhliche Mäuse und Vögel. Die Stiefschwestern sind zwar zickig, aber eher komisch als gefährlich. Das Ende ist romantisch: Vergebung und Glitzer statt Rache und Blut.
Aus einer düsteren Moralgeschichte wurde eine strahlende Liebesgeschichte ohne echten Schrecken.
Dornröschen
Ursprung (Basierend auf „Sonne, Mond und Talia“ von Giambattista Basile aus dem 17. Jahrhundert):
Die erste bekannte Fassung dieses Märchens ist alles andere als romantisch:
Dornröschen sticht sich und fällt in einen tiefen Schlaf.
Ein fremder König findet und missbraucht sie, während sie bewusstlos ist. Sie gebärt Zwillinge, während sie noch schläft. Erst als eines der Babys an ihrem Finger saugt, bricht der Fluch. Danach muss Dornröschen gegen die eifersüchtige Königin des Königs kämpfen, die ihre Kinder töten will.
Charles Perrault Version
In seiner Version „Die schlafende Schöne im Walde“ fällt der Kuss des Prinzen weg, und die Prinzessin wird eine Mutter von Kindern, die sie im Schlaf zur Welt bringt.
Die Brüder Grimm:
Die Grimm-Version aus dem Jahr 1812 ist die bekannteste und enthält den Prinzen, der Dornröschen nach einem hundertjährigen Schlaf durch einen Kuss weckt, wodurch auch der Hofstaat erwacht.
In vielen Versionen ist Dornröschen 15, in der Disney Version 16.
Auch die Anzahl der Feen hat sich im Lauf der Zeit verändert.
Frühe Versionen sprechen von sieben Feen, die eine Prinzessin mit Gaben beschenken, und die Gebrüder Grimm erweitern diese Zahl auf 13, die als Unglückszahl gilt. Später kürzt sich die Zahl auf drei Feen und eine vierte nicht eingeladene Fee.
Disney-Version:
Ein Prinz küsst sie sanft wach.
Alle feiern ihre Liebe, und das Königreich lebt glücklich bis ans Ende seiner Tage.
Schneewittchen
Ursprung (Gebrüder Grimm):
Die Königin versucht dreimal, Schneewittchen zu töten:
- Mit einem erstickenden Schnürmieder.
- Mit einem vergifteten Kamm.
- Schließlich mit dem berühmten Apfel.
Am Ende wird sie grausam bestraft. Sie muss in glühenden Eisenpantoffeln tanzen bis sie tot zusammenbricht.
Disney-Version:
Der Mordversuch geschieht nur einmal mit dem Apfel. Die böse Königin stürzt in den Tod, ohne dass Blut fließt. Schneewittchen erwacht durch den Kuss der wahren Liebe und alle sind glücklich.
In manchen frühen Versionen waren die Zwerge die Retter, die die Königin besiegten. Später wird der Prinz als derjenige vorgestellt, der Schneewittchen durch einen Kuss oder durch Zufall von der Königin befreit.
"Für das Sneewittchen hinaus in den Wald an einen weiten abgelegenen Ort, da stichs todt, und zum Wahrzeichen bring mir seine Lunge und seine Leber mit, die will ich mit Salz kochen und essen." – lautete der Auftrag der Königin an den Jäger.
Rotkäppchen
Ursprung (Charles Perrault):
Der Wolf frisst die Großmutter und verkleidet sich als sie.
Rotkäppchen ahnt nichts, bis es zu spät ist. In der ersten Fassung stirbt Rotkäppchen. Die Geschichte war eine klare Warnung an junge Mädchen, sich nicht mit Fremden einzulassen (der Wolf stand symbolisch für gefährliche Männer).
moderne Kinderfassung:
Ein Jäger erscheint rechtzeitig und rettet sowohl Großmutter als auch Rotkäppchen.
Der Wolf wird bestraft, aber niemand stirbt.
Rotkäppchen ist dabei eine Erzählung, die lange Zeit nur mündlich überliefert wurde, ehe sie von Perrault verschriftlich wurde 1695/1697 und später von den Gebrüdern Grimm.
Im Lauf der Zeit veränderte sich die Geschichte. Auch der kannibalistische Aspekt verlor sich mit der Zeit, wo Rotkäppchen unwissentlich vom Fleisch der Großmutter aß und ihr Blut trank, was bereits von Perrault zensiert wurde, da er für den französischen Hof von Versailles schrieb und alles zensierte, was vulgär hätte sein können. Dafür finden sich Anspielungen auf Sexualität (Rotkäppchen legt sich nackt zum Wolf ins Bett).
Arielle, die Meerjungfrau
Ursprung (Hans Christian Andersen):
Die kleine Meerjungfrau verkauft ihre Stimme für Beine, um die Liebe des Prinzen zu gewinnen. Jeder Schritt auf ihren Beinen fühlt sich an, als würde sie auf Messern laufen.
Am Ende wählt der Prinz eine andere Frau. Die Meerjungfrau stirbt, verwandelt sich in Meerschaum und löst sich im Meer auf.
Disney-Version:
Arielle bekommt ihre Stimme zurück und heiratet ihren Prinzen.
Ein fröhliches Happy End mit Gesang und einer Vereinigung zwischen Land- und Meeresbewohnern
Hänsel und Gretel
Ursprung (Gebrüder Grimm, 1812):
Während einer Hungersnot beschließt die Mutter, die Kinder im Wald auszusetzen, weil die Familie sonst verhungert.
Hänsel und Gretel folgen einer Spur aus Steinen, womit sie wieder nach Hause finden. Beim zweiten Mal wollen sie einer Spur aus Brotkrumen folgen, doch beim zweiten Mal finden sie nicht mehr zurück.
Die Hexe lockt sie mit einem Lebkuchenhaus. Sie mästet Hänsel, um ihn zu schlachten und zu essen. Gretel wird als Sklavin gehalten, die arbeiten muss, bis ihr Bruder geschlachtet wird. Die Hexe ist eine Kannibalin.
Gretel stößt die Hexe in den Ofen, die beim lebendigen Leib verbrennt.
Am Ende finden die Kinder das Gold der Hexe, kehren heim. Die Mutter ist inzwischen tot.
Hänsel und Gretel war ein Survival-Horror-Märchen über Hunger, Tod und menschliche Gier. Es spiegelte die Realität vieler Familien im Mittelalter und während Hungersnöten.
Moderne Version:
Aus der Mutter wurde im Laufe der Zeit eine böse Stiefmutter, damit die Figur der liebenden Mutter keinen schlechten Ruf bekommt. Sie befiehlt dem Vater die Kinder im Wald auszusetzen.
Die Hungersnot wird kaum erwähnt oder verharmlost durch Geldsorgen.
Die Hexe ist nicht mehr eindeutig kannibalistisch, sondern eher eine schrullige Zauberin.
Das grausame Ende wird abgeschwächt: Die Hexe „verschwindet“, ohne blutige Details. Das Happy End: Die Familie ist wieder vereint, alle Gefahren sind besiegt.
Auf dem Pfad der Gebrüder Grimm
Der Pfad der Brüder Grimm" ist eine über 600 Kilometer lange Ferienstraße, die von Hanau (Geburtsort der Brüder) bis nach Bremen führt.
Im Reinhardswald befindet sich die Sababurg einer der Höhepunkte der Ferienstraße. Der Sage nach soll hier Dornröschen in ihren 100-jährigen Schlaf gefallen sein.
In Hameln kann man auf den Spuren des Rattenfängers wandeln, der aus Rache für eine nicht beglichene Rechnung die Kinder von Hameln mit seinem Flötenspiel aus der Stadt lockte.
Der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel soll eine große Inspiration für die Gebrüder gewesen sein.
Auch zahlreichen Museen rund um die Wanderstrecke, Veranstaltungen undAusstellungen sind um die Wanderstrecke herum zu finden. Es gibt regelmäßige Veranstaltungen und Angebote zum Thema.
Märchen und ihre Rolle in der NS-Zeit
Märchen waren nie nur harmlose Geschichten. Sie wurden immer auch als Mittel zur Erziehung und Beeinflussung genutzt.
Ein besonders dunkles Kapitel in ihrer Geschichte begann während der Zeit des Nationalsozialismus. Die Nationalsozialisten erkannten schnell, wie mächtig Märchen als Werkzeug für Propaganda sein konnten.
Joseph Goebbels, der Reichspropagandaminister, ließ gezielt Märchenstoffe nutzen, um die Ideologie des Regimes zu verbreiten.
Die Geschichten wurden so umgedeutet, dass sie rassistische, antisemitische und politische Botschaften transportierten.
Die klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse bot dafür eine perfekte Grundlage.
Rotkäppchen als Film zeigte einen Jäger im Anzug mit Hoheitsabzeichen, der Rotkäppchen und die Großmutter rettet, um eine autoritäre, heroische und überlegene Staatsmacht zu propagieren, während der Wolf als Sinnbild für den "Feind" dargestellt wird.
Der Film nutzt die bekannte Märchenhandlung, um sie mit einer Rahmenhandlung zu verknüpfen, die in der Zeit des Nationalsozialismus angesiedelt ist.
Schneewittchen als Propagandafigur
Besonders Schneewittchen wurde instrumentalisiert:
Die „schöne, reine, weiße Prinzessin“ wurde als Idealbild der arischen Frau dargestellt. Unschuldig, rein und passiv wartend auf ihre Rettung durch den starken Prinzen.
Die böse Königin hingegen symbolisierte Eifersucht, Verderbtheit und „fremde Einflüsse“, die das „Reine“ bedrohen.
Die sieben Zwerge standen sinnbildlich für eine eingeschworene Gemeinschaft, die fleißig arbeitet und der Prinzessin zur Seite steht. Ein Bild, das stark romantisiert und im Sinne der NS-Ideologie gedeutet wurde.
Sogar Walt Disneys Verfilmung Schneewittchen und die sieben Zwerge von 1937 wurde von den Nationalsozialisten genau beobachtet.
Der Film selbst war zwar keine Propaganda, doch die klare Bildsprache und die Darstellung der Figuren wurden von Goebbels gelobt und galt als Lieblingsfilm von Adolf Hitler.
Er sah darin das Potenzial, die Geschichte für deutsche Propagandazwecke zu nutzen.
Darüber hinaus wurden während der NS-Zeit in Schulen gezielt Grimm’sche Märchen vorgelesen und diskutiert.
Die Kinder sollten aus den Märchen lernen, sich dem „Führerprinzip“ unterzuordnen, Loyalität zu zeigen und „fremde Bedrohungen“ zu erkennen. Eine gefährliche Verzerrung dieser eigentlich zeitlosen Geschichten.
Warum Märchen zensiert wurden
Nach dem Krieg änderte sich der Blick auf Märchen erneut.
Die grausamen, unzensierten Originale galten plötzlich als zu brutal für die Nachkriegsgeneration.
Gleichzeitig wollte man sich von der ideologischen Instrumentalisierung durch die Nationalsozialisten distanzieren.
Das führte dazu, dass viele Märchen erneut entschärft und familienfreundlicher gemacht wurden.
Disney hatte diesen Prozess schon 1937 mit Schneewittchen angestoßen.
Die düsteren Botschaften wichen Liebe, Hoffnung und Happy Ends. Eine bunte Gegenwelt zu der grausamen Realität der Zeit.
Damit verschwanden auch die ursprünglichen gesellschaftlichen Spiegelungen und moralischen Warnungen, die Märchen einst auszeichneten.
How to Kill a Fairytale – Zurück zu den dunklen Wurzeln
Eine magische Grenze, die die Welten der Menschen und Märchen trennt.
Eine verrückte Prinzessin, die sie zerstören will.
Eine böse Fee, deren Herz alles retten könnte.
Als dreizehnte Fee habe ich wegen eines Fehlers alles verloren und wirklich gedacht, das Schicksal wäre mit mir fertig.
Bis er vor mir steht – Landon, Auftragsmörder aus der Menschenwelt und Nachfahre der Naraar.
Ein alter Wunsch bindet uns aneinander und zwingt mich, ihm zu helfen, der Märchenwelt für immer den Rücken zu kehren. Auch wenn ich ihn nur zu gern nie wieder sehen möchte, kochen zwischen uns nicht nur Streitereien, sondern auch verbotene Gefühle hoch. Umgeben von Hänsel und Gretel, dem bösen Wolf und Cinderella, prickelt es gewaltig, doch nichts davon dürfen wir zulassen. Vor allem, als Dornröschen beginnt, auf Welteroberungstour zu gehen, und wir plötzlich die Einzigen sind, die sie stoppen können. Was verbindet Landon und mich wirklich?
Der Auftakt der düsteren Romantasy-Dilogie von Anny Thorn voller Märchen der etwas anderen Art, unerwarteten Intrigen und einer unmöglichen, jedoch heißen und eventuell vorherbestimmten Liebe.
Märchen sind mehr als nur Geschichten für Kinder.
Sie sind lebendige Zeugnisse unserer Kultur. Geschichten, die sich über Jahrhunderte verändert haben.
Wer brave Feen erwartet oder den Prinzen in glänzender Rüstung, wird bei dem Buch „How to Kill a Fairytale“ von Anny Thorn vergeblich warten müssen. Das Buch greift die ursprünglichen Fassungen mit auf und erzählt in einer eigenen Welt von der dreizehnten Fee.








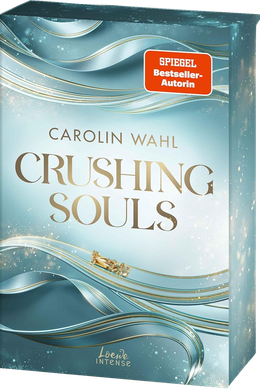

.png)







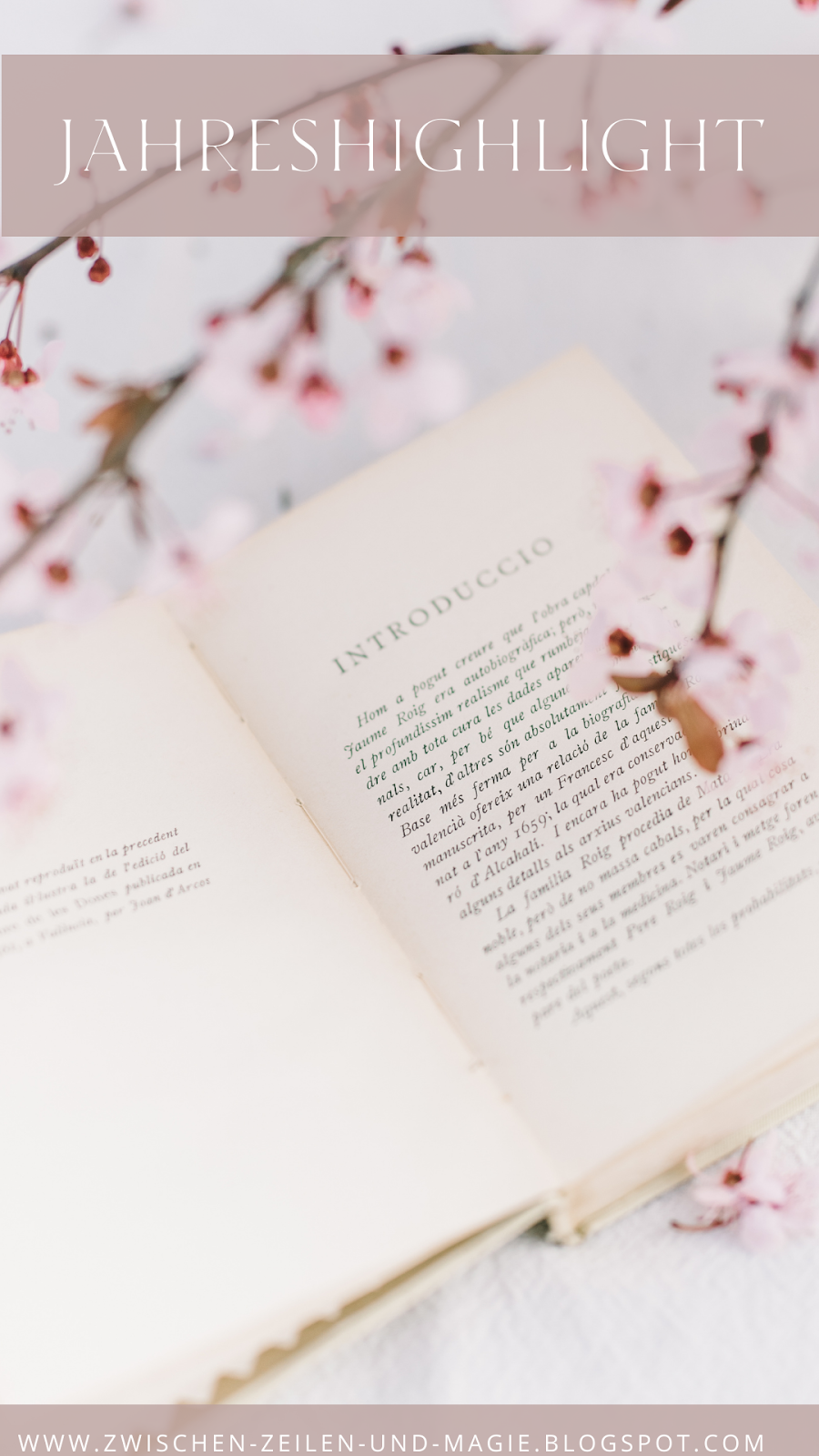
0 comments:
Kommentar veröffentlichen
Hallo!
Danke, dass du diesen Blogeintrag gefunden und gelesen hast - Lass mir doch einen Kommentar da!